W.Wir alle haben es irgendwann gespürt, obwohl wir es nicht gerne zugeben: Neid. Ein verdammt starkes Gefühl, das uns ansonsten zivilisierte Arten stören kann – obwohl wir wissen, dass es völlig irrational ist. Es liegt in unserer Natur, immer nach den besten Möglichkeiten für uns zu streben. Und wenn wir es nicht bekommen, werden wir eifersüchtig.
Professor Claudius Gros von der Goethe-Universität in Frankfurt am Main hat gefragt, warum das so ist Untersuchung ein genauerer Blick – mit spieltheoretischen Strategien. In der Tat ist Gros Spezialität die theoretische Physik. Klingt zunächst weit entfernt von psychologischer und sozialer Dynamik, aber was Sie vielleicht nicht wissen: Theoretische Physiker lieben es, über Annahmen zu philosophieren und sie mathematisch zu begründen.
Ist Neid von der Herkunft abhängig oder sind wir selbst dafür verantwortlich?
Vielleicht erinnern Sie sich an dieses Szenario aus Ihrer Schulzeit: Während einige Kinder über ihre Sommerferien in einem Fünf-Sterne-Hotel auf Mauritius sprachen, ging es in Ihrem Urlaubsessay um Camping am Nordseestrand. Schön auch, aber immer noch eifersüchtig auf die Luxusferien der anderen Kinder. Sie konnten das Urlaubsziel und den damit verbundenen höheren sozialen Status als Kind jedoch nicht aktiv beeinflussen. In diesem Fall war Ihre Herkunft die Ursache für Neid.
Aber manchmal produzieren wir gerne selbst Neid, wie Gros in seiner Studie demonstrieren konnte.
Zunächst wollte ich herausfinden, ob sich soziale Unterschiede entwickeln, auch wenn von Anfang an niemand einen Vorteil hat.
In seiner Studie ging er davon aus, dass es in jeder Gesellschaft Dinge gibt, die erwünscht, aber rar sind: zum Beispiel bestimmte Jobs, soziale Kontakte und Machtpositionen. Wenn Sie eines davon nicht bekommen können und sich mit einer schlechteren Alternative zufrieden geben müssen, entstehen Ungleichheiten. In der Spieltheorie werden solche Entscheidungen und ihre Ergebnisse reproduziert und verständlich gemacht. Schließlich gibt es hinter jeder Entscheidung, wie Sie Ihren Traumjob bekommen, eine bestimmte Strategie – wie in einem Spiel.
In einem solchen Entscheidungsprozess beeinflussen sich die Akteure gegenseitig. Denn der Erfolg des Einzelnen hängt nicht nur von seinen eigenen Handlungen ab, sondern auch von anderen. Sie haben vielleicht schon einmal von „Nash Equilibrium“ gehört. Das Konzept wurde von dem Mathematiker John Forbes Nash in seiner Dissertation von 1950 am Beispiel von Pokerspielern entwickelt:
Wenn sich alle in derselben Position befinden, ist es für keinen der Spieler von Vorteil, seine Strategie zu ändern, wenn die anderen Spieler ebenfalls an ihren Strategien festhalten. Nur wenn es eine Chance gibt, dass man es ein bisschen besser kann als die anderen, probieren wir neue Verhaltensmuster aus. Dieses Prinzip kann auf praktisch jedes Leben im Leben angewendet werden.
Was bedeutet das für den Neid, den wir fühlen?
Quelle: Getty Images / Westend61
Wenn wir der Logik des Nash-Gleichgewichts folgen, hat jeder in einem sozialen Umfeld im Grunde die gleiche Position. Sie haben also keinen Vorteil in Ihrem eigenen sozialen Umfeld, wenn Sie anders handeln. Dies ändert sich jedoch, sobald Sie jemanden treffen, der aus einem anderen, höheren sozialen Umfeld stammt, beispielsweise ein höheres Einkommen oder eine schönere Wohnung hat. Dann könnten Sie etwas tun, das Sie besser aussehen lässt. Sie motivieren sich also, besser zu werden. Zum Beispiel, indem Sie einen Job annehmen, um mehr Geld zu verdienen und sich eine größere Wohnung zu leisten. In der Spieltheorie wird dies als „gemischte Strategie“ bezeichnet.
Wer sozial besser ist, muss nicht darauf zurückgreifen: Er bleibt bei der Aktivität, die seinen aktuellen Status ermöglicht. Dies wird wiederum als „reine Strategie“ bezeichnet.
Natürlich hat ein gemischter Ansatz, sobald Sie sich in einer schwächeren Position befinden, Konsequenzen für die soziale Interaktion. Wir zeichnen uns dadurch aus, dass wir uns ständig vergleichen. Und es schafft Neid.
Die Oberschicht ist daher individualistisch, während Agenten der Unterschicht mit der Menge verschmelzen.
Sie erstellen den Wettbewerb selbst
In diesem Annahmemodell ist es ein Zufall, ob Sie in der oberen oder unteren Klasse landen, da nicht Ihre Herkunft, sondern die Wettbewerbsdynamik bestimmt. Gros nennt dies das „Einkaufsproblemmodell“. Wir selbst tragen zur Schaffung von Ungleichheiten bei, weil wir uns in ständigem Wettbewerb sehen und nach dem streben, was für uns am besten ist.
Quelle: Getty Images / Robert Daly
Daraus schließt er, dass die Politik als zusätzlicher Akteur in der Gesellschaft weniger Einfluss darauf hat, diese selbstinduzierten Unterschiede auszugleichen. Sie verliert einen Teil ihrer Kontrolle, weil sich die Gesellschaft spontan und angemessen in soziale Klassen aufteilt.
Selbst eine „ideale Gesellschaft“ kann auf lange Sicht nicht stabil gehalten werden – was letztendlich auch das Streben nach einer kommunistischen Gesellschaft unrealistisch erscheinen lässt.
Je intensiver der Wettbewerb um knappe Ressourcen ist, desto stärker wirkt sich der Neid aus, weil er uns wünschenswerter erscheint. Diese Annahme hält jedoch nur so lange an, wie wir davon ausgehen, dass wir uns nie alle in derselben Position befinden.

Begeisterter Zombie-Fan. Subtil charmanter Musikfreak. Explorer. Internet-Junkie. Web-Anwalt. Hardcore-Organisator.











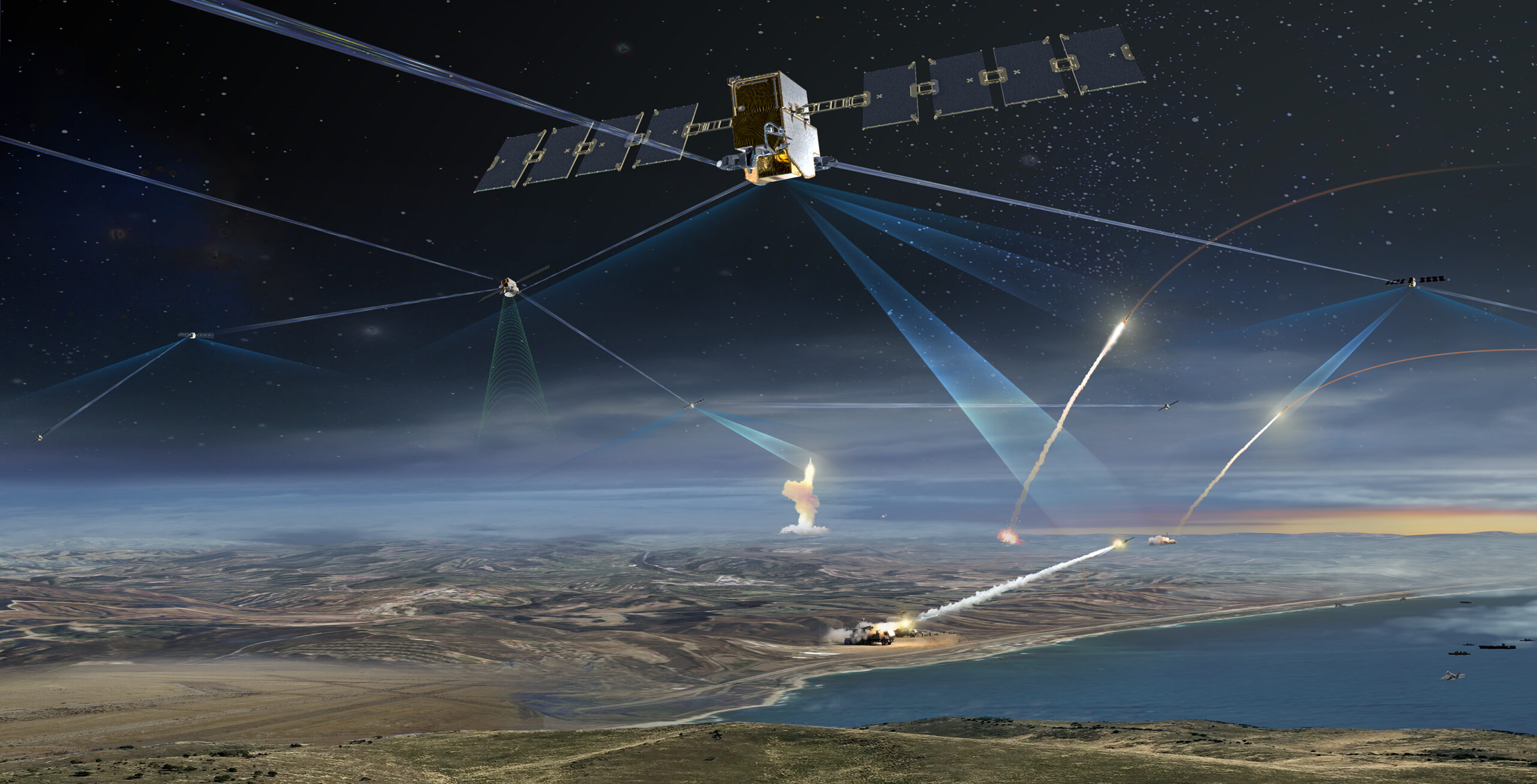












+ There are no comments
Add yours