Warum ist der Weltraumfilm so emotional störend? Warum weinst du, wenn Sandra Bullock in „Schwere„Endlich gelingt es, in einer chinesischen Kapsel zu Boden zu gehen? Wann in“Interstellar„Matthew McConaughey dockt den Kleinen an das große Raumschiff an? Wenn Matt Damon drin ist“Marschieren„Endlich gelingt es, Mars-Kartoffeln anzubauen? Weil diese Filme ihre Helden in die größtmögliche und unvorstellbare Extremsituation bringen. Sie können nicht einsamer, verlorener, verletzlicher sein als im unendlichen Raum, dieses feindliche Nichts.
Kann es sogar erhöht werden? Diese Frage ärgerte offensichtlich die Macher dieser neuen Netflix-Serie. Laut „Away“ kann man sagen: Okay. Das Ergebnis ist jedoch nicht sehr überzeugend. Eher wie emotionaler Overkill.
In zehn Folgen sehen wir ein fünfköpfiges Team auf ihrer Mission. Angeführt von Emma Green (stoisch gespielt von Hilary Swank) Astronauten müssen ein Jahr zum Mars reisen, dort ein Jahr verbringen und ein Jahr zurückfliegen. Wer jedoch erwartet, in diesen zehn Stunden dem Unverzichtbaren im Universum näher zu kommen, wird enttäuscht sein. Weil es nicht wirklich um Raumfahrt geht. Es geht um lesbische Liebe, die es nicht sein sollte. Über die Vater-Tochter-Beziehung. Über Mutter-Tochter-Beziehung. Und die Frage, was es für eine Ehe bedeutet, wenn ein Partner drei Jahre weg ist.
Da „Away“ den Astronauten an Bord des „Atlas“ nur teilweise folgt, findet der zweite Teil der Serie mit den auf der Erde verbliebenen statt, hauptsächlich mit der Familie von Commander Green. Ihr Mann bekommt von Anfang an einen Schlaganfall. Die Tochter ist ein Teenager und gleicht die Abwesenheit ihrer Mutter aus, indem sie mit halsbrecherischer Geschwindigkeit auf einem Motocross-Motorrad über schlammige Hänge fährt.
Aus diesem Gegensatz heraus – die überlebensgroße Mars-Mission einerseits und die familiären Herausforderungen andererseits – versucht „Away“, emotionales Kapital zu schaffen. Und es funktioniert. Eine Sequenz, in der die fünf isolierten Astronauten dem Tod kaum durch Ersticken oder Durst entkommen und die ganze Welt per Livestream zuschaut, bewegt sich lange. Es wird beunruhigender und bewegender, wenn die Tochter zurückgelassen wird und der Mann im Rollstuhl die letzten Worte seiner Mutter hört – die die NASA vorsichtshalber sendet, wenn sie nicht überlebt.
Erst nach der Hälfte beginnt ein seltsames Gefühl der Übersättigung. Zu viel Pathos. Zu viele letzte Abschiede, die es nicht sind. Zu viele Saul-Paul-Geschichten. Wenn der Tod in jeder Episode mindestens zweimal überwunden wird, wird er irgendwann nicht mehr ernst genommen. Besonders wenn die hoffnungsvolle und erhebende Stimmung in der Serie von Anfang an darauf hindeutet, dass hier nicht das Schlimmste passieren wird. Und dann passiert es.
Es ist paradox: Gerade weil alles so unglaublich ernst genommen wird, verlieren die Höhepunkte jeder Episode an Spannung. Die existenziellen Probleme degenerieren zu Herausforderungen, die gemeistert werden müssen. Von der Besatzung an Bord des Raumschiffs. Von Ehemännern, Töchtern und Liebhabern auf Erden. Und weil die Macher nicht entscheiden können, wo genau der Fokus liegen soll, werden zu viele Charaktere und Schicksale in den Vordergrund gerückt – die dann mit holzschnittartigen Hintergrundgeschichten versehen werden müssen.
Die Reise zum Mars, die menschliche Sehnsucht nach einem Funken Hoffnung, dass man nicht allein im Universum ist – das allein wäre tatsächlich genug emotionaler Treibstoff für viele Konsequenzen. Der irdische Ballast von „weg“ fügt dieser Geschichte nichts Bedeutendes hinzu, er belastet sie nur.
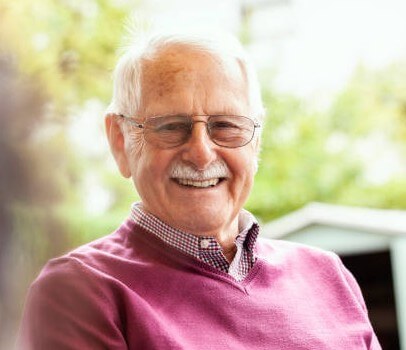
Wannabe Internet-Spezialist. Alkohol-Nerd. Hardcore-Kaffee-Anwalt. Ergebener Twitter-Enthusiast.


















+ There are no comments
Add yours