Tambo und ihre Töchter waren zuerst aus einem abgelegenen Dorf im Amazonas-Regenwald in die peruanische Hauptstadt gekommen, damit ihre älteste, Amelie, als erstes Familienmitglied die Universität besuchen konnte.
Der 17-Jährige hatte ein angesehenes Stipendium für ein Studium an der Universidad Científica del Sur in Lima erhalten, und die Familie hatte große Träume. Sie mieteten ein kleines Zimmer, halfen Amelie beim Einstieg und Maria kratzte etwas Geld zusammen, um in einem Restaurant zu arbeiten.
Nach fast zwei Monaten Quarantäne hatten sie kein Geld mehr, um ihr gemietetes Zimmer oder Essen zu bezahlen. Tambo beschloss, in ihr 350 Meilen entferntes Dorf in der Region Ucayali zurückzukehren.
Bei stillgelegten öffentlichen Verkehrsmitteln bestand die einzige Möglichkeit darin, die Reise zu Fuß zu unternehmen. „Ich kenne die Gefahr, in die ich meine Kinder stecke, aber ich habe keine Wahl“, sagte sie. „Ich sterbe entweder beim Versuch hier raus zu kommen oder verhungere in meinem Zimmer.“
Flucht aus der Stadt
Ich traf Tambo, 40, über eine WhatsApp-Gruppe, in der Tausende Peruaner darüber sprachen, wie sie Lima verlassen würden, um in ihre Häuser zurückzukehren. „Ich habe mein Haus nicht verlassen, seit die Regierung die Quarantäne erklärt hat“, sagte sie mir. „Aber ich habe kein Geld mehr.“
Sie stimmte zu, dass ich ihr auf der gefährlichen Reise folgen durfte, um ihre Geschichte zu erzählen, unsicher, wie das Ergebnis aussehen würde.
Tambo und ihre Töchter verließen Lima Anfang Mai. Sie trug eine Gesichtsmaske und trug Melec auf dem Rücken zusammen mit einem großen bunten Rucksack, der mit kleinen Herzen bestreut war. Amelie und die siebenjährige Yacira stapften an ihrer Seite und schleppten ihre eigenen Rucksäcke. Ein rosa Bär hing an Yaciras Rucksack.
Ihre epische Reise entlang staubiger Autobahnen, Eisenbahnschienen und dunkler Landstraßen würde die Tambos durch die hochgelegene Andenregion führen, bevor sie den Amazonas-Regenwald erreichen würden – eine gefährliche Route für eine Frau, die alleine mit drei Kindern reist.
Stunde für Stunde gingen wir in der Hitze spazieren und sahen zu, wie sie vorwärts drängten. Wasser und Essen waren knapp, Tambos Gefühle waren rau. Sie weinte, als sie leise zu ihrem Baby Melec sang. „Es gibt keinen Weg, du machst deinen eigenen Weg“, summte sie.
Es gab Momente der Freundlichkeit und Erleichterung, als sie die Reise durch ein paar Fahrten auf dem Weg abbrachen. Ein Fahrer warf ihnen Essen zu, als er vorbeifuhr. Aber die meiste Zeit gingen Tambo und ihre Töchter.
Am dritten Tag, als sie in der Luft in der Nähe der Anden, 15.000 Fuß über dem Meeresspiegel, kämpften, sahen wir, wie ein Trucker Mitleid mit der Familie hatte, sie in die nächste Stadt fuhr und etwas von seinem Essen teilte. „Ich bin so viel gelaufen“, sagte sie dem Fahrer und versuchte, die Tränen der Dankbarkeit zurückzuhalten.
Es war eine kurze Pause für ihre Füße. „Die Hände meiner Tochter wurden lila“, sagte sie zu ihm. „Ich dachte, sie würde es nicht schaffen.“
Checkpoints auf dem Weg
Der Heimweg war mehr als nur Ausdauer. Tambo musste auch Polizeikontrollpunkte navigieren, um zu verhindern, dass Bewohner von Lima, dem Coronavirus-Epizentrum des Landes, das Virus auf ländliche Gebiete übertragen.
In San Ramon, kurz bevor Tambo den Dschungel betrat, sahen wir, wie ein Polizist sie verhörte. „Sie können hier nicht mit Kindern vorbeikommen“, sagte der Beamte. Tambo verhandelte mit ihm. „Ich gehe nur zurück zu meiner Farm in Chaparnaranja, wo ich schon seit einer Woche bin.“
Es war eine Lüge. Sie konnte dem Offizier nicht sagen, dass sie aus Lima kam, oder er würde ihr nicht erlauben, ihre Reise fortzusetzen.
Aber die erschöpfte Mutter hielt durch. Sie tat, was sie tun musste, um zu überleben, sagte sie uns. Das Virus war nicht so beängstigend wie vor Hunger zu sterben.
Nach sieben Tagen und Nächten und 300 Meilen erreichten Tambo und ihre Kinder ihre Heimatprovinz, die Region Ucayali, in der auch die indigenen Ashaninka leben.
Eine letzte Hürde lag auf ihrem Weg – die Einreise in das Gebiet war wegen des Virus verboten.
„Was würde passieren, wenn eine infizierte Person hereinkommt? Wie entkommen wir?“ Einer der örtlichen Ashaninka-Führer erzählte es uns. „Das einzige Beatmungsgerät, das wir haben, ist die Luft. Unser Gesundheitszentrum hat nichts, um das Virus zu bekämpfen.“
Aber Tambo war entschlossen. Sie verhandelte mit den örtlichen Führern und durfte nach Hause gehen – unter der Bedingung, dass sie und die Kinder sich 14 Tage lang isolieren.
Sie kamen nachts an, Tambo war überwältigt, als die Familienhunde rannten, um sie zu begrüßen. Sie fiel auf die Knie und schluchzte und dankte Gott, dass er sie nach Hause gebracht hatte, als die Tiere mit dem Schwanz wedelten und sich an das Kind in ihren Armen schmiegten.
Als die Tränen flossen, tauchten ihr Ehemann Kafet und ihr Schwiegervater aus der Dunkelheit auf.
Es gab Freude, aber Distanz. Niemand konnte anfassen. Niemand konnte wegen des Virus umarmen.
„Es war so schwierig, wir haben so viel gelitten“, sagte sie unter Tränen.
„Ich will nie wieder nach Lima. Ich dachte, ich würde dort mit meinen Mädchen sterben.“
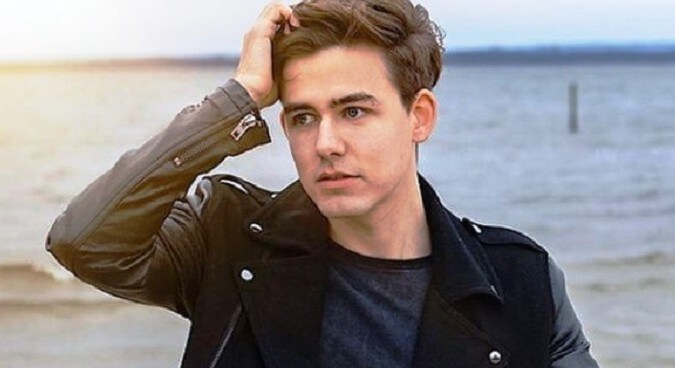
Speckfanatiker. Entdecker. Musikwissenschaftler. Internetaholic. Organisator. Introvertiert. Schriftsteller. Twitter-Fan. Student.


















+ There are no comments
Add yours